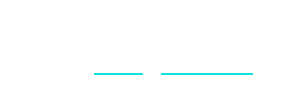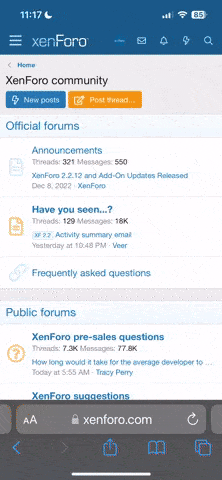CdB
Citizen of Zooville
Hallo,
ich war im Zweifel, unter welcher Rubrik ich dieses Thema posten sollte. Einerseits gibt es eine Rubrik für Animal Health and Wellbeing, andererseits ist die Quelle der Informationen die Ausgabe 6.25 des Magazins Spektrum der Wissenschaft, also nur in Deutsch verfügbar und auch das Thema an sich wurde von deutschen Forschern veröffentlicht. Daher habe ich es nun doch lieber hier im deutschen Teil verfasst.
Es geht also um neueste Erkenntnisse aus der Verhaltensbiologie, im konkreten Fall darum, Nutztieren gerecht zu werden. Im Speziellen sind hier gemeint Schweine Rinder und Ziegen. Anhand der Schilderung von diversen Experimenten soll ein aktueller Eindruck vom Stand der Forschung vermittelt werden.
Forschungsarbeiten der letzten Jahre zeigen, diese Tiere verfügen über ein wesentlich komplexeres mentales Innenleben, als ihnen landläufig so zugedacht wird. Diese Erkenntnis beeinflusst entscheidend unser Verständnis von Tierwohl und erfordert ein generelles Umdenken darüber, wie wir Nutztiere halten und behandeln.
Schweine, Rinder und Ziegen offenbaren sich als intelligente, einfühlsame Wesen. Für Halter dieser Tiere, die sie nicht als Nutztiere halten, mag die Erkenntnis nicht umfassend neu sein, aber nun lässt sie sich wissenschaftlich untermauern. Diese und auch andere Nutztiere zeigen ein erstaunlich komplexes kognitives, emotionales und soziales Verhalten.
Experiment mit Ferkeln:
Ferkeln wird beigebracht, wenn sie in einen Raum kommen, eine von zweien Boxen anzusteuern. Wenn sie sie öffnen, erhalten sie von der einen eine Futterbelohnung, von der anderen einen Schreck durch eine knisternde Plastiktüte. Aber was passiert, wenn man eine Futterbox mittig in den Raum stellt? Manche Ferkel gehen hin, und öffnen die Box, andere tun es nicht. Ängstliche Tiere bewerten die Situation eher negativ und bleiben der Box fern. Optimistische Ferkel dagegen öffnen die Box. Diesen Versuchsaufbau nutzen Forscher, um Rückschlüsse über den emotionalen Zustand der Tiere herauszufinden. Weitergehende Versuche ergaben, es hängt vom Serotoninspiegel im Gehirn ab, ob ein Ferkel eher Pessimist oder Optimist ist. Die Erkenntnis war, Optimisten sind mental ausgeglichenere Tiere und haben ein höheres Wohlbefinden.
Dass unsere Nutztiere im Laufe der Evolution nicht nur ihr Verhalten und Fitness zur Steigerung der Überlebensfähigkeit und Weitergabe von Genen an die nächste Generation optimiert haben, sondern auch ihre Emotionen, Bewertung und Reaktion auf Situationen, da sie dadurch ebenfalls Selektionsvorteile erlangen, haben die Fachleute lange Zeit ignoriert. Schweine beispielsweise werden durch verbesserte Haltung wie weiches Stroh, Spielzeug oder mehr Platz vermehrt zu Optimisten. Das lässt sich leicht durch Vergleiche mit Kontrollgruppen in Standardhaltung beweisen.
1979 stellte das britische Farm Animal Welfare Committee (FAWC) in einer Pressemitteilung bestimmte Mindestanforderungen für die Haltung von Tieren vor. Diese wurden unter der Federführung des Veterinärmediziners John Webster von der University of Bristol zum Konzept der fünf "Freiheiten" weiterentwickelt. Es besagt, dass Tiere frei sein sollten von:
1. Hunger, Durst und Mangelernährung
2. Unbehagen und Unwohlsein (das beinhaltet auch Sexualität)
3. Schmerzen, Verletzungen oder Krankheiten
4. Angst und Leiden
5. Einschränkung der Freiheit, normale Verhaltensweisen auszuleben (das beinhaltet ebenfalls Sexualität)
Dieses Konzept ist weite verbreitet und anerkannt. Aber es formuliert nur eine Idealvorstellung des Menschen, wobei der Fokus auf den Aspekten liegt, die das Tierwohl negativ beeinflussen. Was fehlt, ist der Bereich der affektiven und kognitiven Reaktionen. Das Forscherteam im veröffentlichten Artikel geht davon aus, dass dieser Bereich ganz wesentlich zum Wohlbefinden von Nutztieren beiträgt.
Die Frage nach der tierischen Befindlichkeit stellt sich vor allem dann, wenn man einer bestimmten Spezies kognitive Fähigkeiten zugesteht, die es ihr ermöglichen, ihren eigenen Zustand wahrzunehmen und zu bewerten. Zumindest die affektiven Komponenten spielen in etlichen neueren Animal-Welfare-Konzepten eine wichtige Rolle. Es gibt zum Beispiel das Fünf-Domänen-Modell von David Mellor von der University of New England in Australien. Darin gibt es neben den körperlich-funktionnellen Bereichen Ernährung, Umwelt, Gesundheit und Verhalten noch den Fünften Sektor, die Affektdomäne. Die Erfahrungen der Tiere in den ersten vier Domänen fließen dann in die positive oder negative Bewertung durch die Tiere in die affektiv-mentale fünfte Domäne ein. Und die bestimmt letztlich die Qualität des Wohlbefindens.
Die Forscher überlegten, wie sie Haltungsbedingungen verbessern und besser an die Bedürfnisse der Tiere anpassen könnten und artspezifisches Verhalten durch adäquate Umweltanreicherungen fördern. Dazu erschien es vielversprechend, die kognitiven Fähigkeiten von Nutztieren durch passende Aufgaben zu nutzen. Beispielsweise sollte jedes Schwein in einer Versuchsgruppe lernen, individuell auf einen Ton in bestimmter Tonhöhe zu reagieren, indem es eine Futterbelohnung erhält. Zusätzlich mussten die Schweine noch lernen, für die Futterausgabe einen Druckschalter mit der Schnauze zu bedienen. Die Einzeltöne wurden weiterentwickelt zu Dreiklängen und schließlich zu dreisilbigen Namen. Dies wurde bis zu 25 Mal am Tag trainiert, so dass die Schweine ihr gesamtes Futter auf diese Weise erhielten. Die Schweine bewältigten diese Herausforderung innerhalb weniger Tage.
Durch diese Aufrufe bewegten sich die Schweine viel mehr als sonst, aber es ergaben sich auch eine Reihe von psychophysiologischen Effekten. Dazu gehörte ein gestärktes Immunsystem, verbesserte Wundheilung, verminderte Aggressivität in der Gruppe bis hin zu weniger Angstreaktionen. Die spannendste Frage war aber, ob sich die emotionalen Bewertungstendenzen der Tiere ebenfalls änderten - und das taten sie! Es verringerten sie sich spezifische Rezeptoren, die für die Regulation von Stress und Emotionen eine Rolle spielen. Die Herzfrequenz sank was in Kombination mit den gemessenen Veränderungen in der Herzfrequenzvariabilität auf eine durch den Parasympathikus des autonomen Nervensystems vermittelte Entspannung hinweist. Die physiologischen Mechanismen scheinen denen bei uns Menschen zu gleichen, die bei uns zum Beispiel nach einer schwierigen gemeisterten Prüfung ablaufen, nach der wir uns einfach nur gut fühlen.
Kommen wir zu Kühen. Bislang dachte man, sie können ihre Ausscheidungen nur sehr eingeschränkt kontrollieren. Durch die Vermischung von Kot und Urin entsteht Ammoniak, ein indirektes Treibhausgas. Zudem gefährdet es die Gesundheit der Tiere, wenn sie in ihren eigenen Exkrementen liegen, was etwa zu Gelenkproblemen führen kann. Um dies zu verhindern, entwickelten die Forscher eine Art Latrinentraining für Kälber, schließlich müssen auch menschliche Kinder die Kontrolle über ihre Ausscheidungen erlangen, also warum nicht auch Kälber. Die Forscher versuchten dafür den Lerneifer der Tiere zu nutzen.
Bei Nutzung eines bestimmten Ortes bekamen die Kälber Futter, wenn nicht erhielten sie einen kalten Wasserguss. 11 von 16 Kälbern lernten innerhalb von wenigen Tagen, die Kuhtoilette zu nutzen. Für den Halter hat dies den Vorteil, dass der Urin getrennt gesammelt und abtransportiert oder anderweitig genutzt werden kann. Das Erlernen der Harnkontrolle bedeutet, dass die Kälber über ein interozeptives Bewusstsein verfügen, also die Fähigkeit, wahrzunehmen, was in ihrem eigenen Körper vor sich geht. Das Experiment zeigt verallgemeinert, wie eng Lernen, Wahrnehmen und Fühlen und damit die Grundvoraussetzungen für die Existenz von Bewusstsein miteinander verknüpft sind.
Von vielen sozial lebenden Tieren ist bekannt, dass bereits die Anwesenheit eines vertrauten Artgenossen oder menschlichen Bezugspartners Stress abpuffern kann, der beispielsweise nach der Trennung von der Mutter auftreten kann. Die Forscher konnten dies nun auch bei Schweinen und Ziegen nachweisen. Des Weiteren wollten die Forscher herausfinden, ob diese Tiere auch untereinander Empathie empfinden können. Dazu betrachteten sie die akustische Verständigung der Tiere untereinander. Dabei wollten sie außerdem wissen, ob die Laute auch etwas über den emotionalen Zustand aussagen. In einem Playback-Experiment zeigte sich, dass Stresslaute von Artgenossen zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der zuhörenden Tiere führen.
In einem weiteren Versuch ersannen die Forscher eine Box, die Ferkel von außen mit einem Hebel öffnen und so die unbekannte Umgebung erforschen konnten. Aber die Tür fiel hinter den Ferkeln zu und konnte von innen nicht geöffnet werden. Die Ferkel draußen erkannten die Stresslaute der gefangenen Ferkel. In 20 Minuten wurden 85% der 75 Tiere von einem Artgenossen aus der Box herausgelassen. Die Hilfsbereitschaft stieg, stärker klagend das gefangene Ferkel quiekte. Ähnliches wurde schon 2020 von tschechischen Forschern bei Wildschweinen mit Wildkameras beobachtet, die in einem Wildgehege in einer Käfigfalle saßen.
Sollte sich weiterhin bestätigen, dass Schweine eine emotionale Notlage ihrer Artgenossen erkennen, stellen sich eine Reihe von ethischen Fragen bezüglich Wohlbefinden bei der Haltung.
Ein weiteres Experiment befasste sich damit, wie gut Schweine mit Belohnungsaufschub umgehen können. Das heißt, das Tier erkennt, dass es für ein Verhalten nicht sofort, sondern verzögert belohnt wird. Man kennt dies als Marshmallow-Experiment aus den 1970ern. Ein Kind sitzt an einem Tisch, auf dem ein Marshmallow liegt. Das Kind darf die Süßigkeit sofort essen, aber erhält die Information, wenn es etwas wartet, erhält es noch einen zweiten Marshmallow. Wenn es dagegen das erste Marshmallow isst, bevor das zweite da ist, erhält es das zweite nicht. Je nach Alter verstehen Kinder das.
Dieses Experiment wurde seither auch mit verschiedenen Tieren und in abgewandelter Form angewandt. 2021 versuchte es das Forscherteam mit Hausschweinen. Mit etwas Training, in dem der Zeitpunkt bis zum zweiten Leckerli immer weiter hinausgezögert wurde, warteten schließlich 13 ältere Schweine bis zu 11 Sekunden, bevor sie sich nicht mehr zurückhalten konnten. Bei Ferkeln schafften es 6 von ihnen bis zu 8 Sekunden zu warten.
Der Test zeigt, das Verhalten vieler Tiere wird durch ein erstaunliches Maß an gegenwärtiger, aber auch auf die unmittelbare Zukunft gerichteter kognitiver Selbstreflexion gesteuert. Damit dürfte auch klar sein, dass auch Hunde sehr wohl lernen können, dass sie eine verzögerte Belohnung für ein zurückliegendes Verhalten bekommen.
Ein weiteres Experiment untersuchte, wie sich Tiere in Gefangenschaft entscheiden, wenn sie vor der Wahl stehen, Futter direkt ohne Aufwand oder erst nach einer Erledigung einer Aufgabe erhalten, also quasi dafür arbeiten müssen. Bei Ziegen zeigte sich, ungefähr ein Drittel entscheidet sich, die Aufgabe zu lösen. Dahinter stecken vermutlich zwei wichtige Verhaltensbedürfnisse: Erstens die selbstmotivierte Suche nach Nahrung und zweitens die Beschaffung von Information. Dieses Wissen kann in der Nutztierhaltung zur Steigerung des Tierwohls angewendet werden, indem man für die Tierart und ihren kognitiven Fähigkeiten geeignete Aufgabenstellungen entwirft.
Und schließlich ging es um die Frage, was tun Tiere, die vor einer Aufgabe stehen, sie aber nicht lösen können. Bei Ziegen versuchten diese dann den menschlichen Versuchsleiter durch Blick- und Körperkontakt dazu zu bewegen, zu Hilfe zu kommen. Dieses Verhalten war bislang von Nutztieren nicht bekannt. Man kennt diese Versuche seit längerem von Haushunden, die mit ihren Bezugsmenschen dann intensiv interagieren. Die Tiere sehen den Menschen als soziale Bezugsperson an. Wölfe in einem Wildgehege tun dies nicht, trotz verfügbarer enger Bezugspersonen. Es ist also ein mit der Domestikation erlerntes vererbtes Verhalten. Solche einfachen Versuche demonstrieren, wie wichtig eine funktionierende Mensch-Tier-Beziehung für Tiere in menschlicher Obhut ist.
Wir haben unsere Nutztiere bezüglich ökonomischem Nutzen und aus hygienischen und arbeitsorganisatorischen Gründen optimiert. Umso erstaunlicher ist es, dass wir zwar einiges über allgemeine und spezielle Verhaltensmuster wissen, allerdings vergleichsweise wenig darüber, was diese als fühlende und denkende Wesen ausmacht und wie sie ihre physische und soziale Umwelt wahrnehmen und bewerten. Dies sollte in der zukünftigen Diskussion ums Tierwohl angemessen berücksichtigt werden.
Grüße
CdB
ich war im Zweifel, unter welcher Rubrik ich dieses Thema posten sollte. Einerseits gibt es eine Rubrik für Animal Health and Wellbeing, andererseits ist die Quelle der Informationen die Ausgabe 6.25 des Magazins Spektrum der Wissenschaft, also nur in Deutsch verfügbar und auch das Thema an sich wurde von deutschen Forschern veröffentlicht. Daher habe ich es nun doch lieber hier im deutschen Teil verfasst.
Es geht also um neueste Erkenntnisse aus der Verhaltensbiologie, im konkreten Fall darum, Nutztieren gerecht zu werden. Im Speziellen sind hier gemeint Schweine Rinder und Ziegen. Anhand der Schilderung von diversen Experimenten soll ein aktueller Eindruck vom Stand der Forschung vermittelt werden.
Forschungsarbeiten der letzten Jahre zeigen, diese Tiere verfügen über ein wesentlich komplexeres mentales Innenleben, als ihnen landläufig so zugedacht wird. Diese Erkenntnis beeinflusst entscheidend unser Verständnis von Tierwohl und erfordert ein generelles Umdenken darüber, wie wir Nutztiere halten und behandeln.
Schweine, Rinder und Ziegen offenbaren sich als intelligente, einfühlsame Wesen. Für Halter dieser Tiere, die sie nicht als Nutztiere halten, mag die Erkenntnis nicht umfassend neu sein, aber nun lässt sie sich wissenschaftlich untermauern. Diese und auch andere Nutztiere zeigen ein erstaunlich komplexes kognitives, emotionales und soziales Verhalten.
Experiment mit Ferkeln:
Ferkeln wird beigebracht, wenn sie in einen Raum kommen, eine von zweien Boxen anzusteuern. Wenn sie sie öffnen, erhalten sie von der einen eine Futterbelohnung, von der anderen einen Schreck durch eine knisternde Plastiktüte. Aber was passiert, wenn man eine Futterbox mittig in den Raum stellt? Manche Ferkel gehen hin, und öffnen die Box, andere tun es nicht. Ängstliche Tiere bewerten die Situation eher negativ und bleiben der Box fern. Optimistische Ferkel dagegen öffnen die Box. Diesen Versuchsaufbau nutzen Forscher, um Rückschlüsse über den emotionalen Zustand der Tiere herauszufinden. Weitergehende Versuche ergaben, es hängt vom Serotoninspiegel im Gehirn ab, ob ein Ferkel eher Pessimist oder Optimist ist. Die Erkenntnis war, Optimisten sind mental ausgeglichenere Tiere und haben ein höheres Wohlbefinden.
Dass unsere Nutztiere im Laufe der Evolution nicht nur ihr Verhalten und Fitness zur Steigerung der Überlebensfähigkeit und Weitergabe von Genen an die nächste Generation optimiert haben, sondern auch ihre Emotionen, Bewertung und Reaktion auf Situationen, da sie dadurch ebenfalls Selektionsvorteile erlangen, haben die Fachleute lange Zeit ignoriert. Schweine beispielsweise werden durch verbesserte Haltung wie weiches Stroh, Spielzeug oder mehr Platz vermehrt zu Optimisten. Das lässt sich leicht durch Vergleiche mit Kontrollgruppen in Standardhaltung beweisen.
1979 stellte das britische Farm Animal Welfare Committee (FAWC) in einer Pressemitteilung bestimmte Mindestanforderungen für die Haltung von Tieren vor. Diese wurden unter der Federführung des Veterinärmediziners John Webster von der University of Bristol zum Konzept der fünf "Freiheiten" weiterentwickelt. Es besagt, dass Tiere frei sein sollten von:
1. Hunger, Durst und Mangelernährung
2. Unbehagen und Unwohlsein (das beinhaltet auch Sexualität)
3. Schmerzen, Verletzungen oder Krankheiten
4. Angst und Leiden
5. Einschränkung der Freiheit, normale Verhaltensweisen auszuleben (das beinhaltet ebenfalls Sexualität)
Dieses Konzept ist weite verbreitet und anerkannt. Aber es formuliert nur eine Idealvorstellung des Menschen, wobei der Fokus auf den Aspekten liegt, die das Tierwohl negativ beeinflussen. Was fehlt, ist der Bereich der affektiven und kognitiven Reaktionen. Das Forscherteam im veröffentlichten Artikel geht davon aus, dass dieser Bereich ganz wesentlich zum Wohlbefinden von Nutztieren beiträgt.
Die Frage nach der tierischen Befindlichkeit stellt sich vor allem dann, wenn man einer bestimmten Spezies kognitive Fähigkeiten zugesteht, die es ihr ermöglichen, ihren eigenen Zustand wahrzunehmen und zu bewerten. Zumindest die affektiven Komponenten spielen in etlichen neueren Animal-Welfare-Konzepten eine wichtige Rolle. Es gibt zum Beispiel das Fünf-Domänen-Modell von David Mellor von der University of New England in Australien. Darin gibt es neben den körperlich-funktionnellen Bereichen Ernährung, Umwelt, Gesundheit und Verhalten noch den Fünften Sektor, die Affektdomäne. Die Erfahrungen der Tiere in den ersten vier Domänen fließen dann in die positive oder negative Bewertung durch die Tiere in die affektiv-mentale fünfte Domäne ein. Und die bestimmt letztlich die Qualität des Wohlbefindens.
Die Forscher überlegten, wie sie Haltungsbedingungen verbessern und besser an die Bedürfnisse der Tiere anpassen könnten und artspezifisches Verhalten durch adäquate Umweltanreicherungen fördern. Dazu erschien es vielversprechend, die kognitiven Fähigkeiten von Nutztieren durch passende Aufgaben zu nutzen. Beispielsweise sollte jedes Schwein in einer Versuchsgruppe lernen, individuell auf einen Ton in bestimmter Tonhöhe zu reagieren, indem es eine Futterbelohnung erhält. Zusätzlich mussten die Schweine noch lernen, für die Futterausgabe einen Druckschalter mit der Schnauze zu bedienen. Die Einzeltöne wurden weiterentwickelt zu Dreiklängen und schließlich zu dreisilbigen Namen. Dies wurde bis zu 25 Mal am Tag trainiert, so dass die Schweine ihr gesamtes Futter auf diese Weise erhielten. Die Schweine bewältigten diese Herausforderung innerhalb weniger Tage.
Durch diese Aufrufe bewegten sich die Schweine viel mehr als sonst, aber es ergaben sich auch eine Reihe von psychophysiologischen Effekten. Dazu gehörte ein gestärktes Immunsystem, verbesserte Wundheilung, verminderte Aggressivität in der Gruppe bis hin zu weniger Angstreaktionen. Die spannendste Frage war aber, ob sich die emotionalen Bewertungstendenzen der Tiere ebenfalls änderten - und das taten sie! Es verringerten sie sich spezifische Rezeptoren, die für die Regulation von Stress und Emotionen eine Rolle spielen. Die Herzfrequenz sank was in Kombination mit den gemessenen Veränderungen in der Herzfrequenzvariabilität auf eine durch den Parasympathikus des autonomen Nervensystems vermittelte Entspannung hinweist. Die physiologischen Mechanismen scheinen denen bei uns Menschen zu gleichen, die bei uns zum Beispiel nach einer schwierigen gemeisterten Prüfung ablaufen, nach der wir uns einfach nur gut fühlen.
Kommen wir zu Kühen. Bislang dachte man, sie können ihre Ausscheidungen nur sehr eingeschränkt kontrollieren. Durch die Vermischung von Kot und Urin entsteht Ammoniak, ein indirektes Treibhausgas. Zudem gefährdet es die Gesundheit der Tiere, wenn sie in ihren eigenen Exkrementen liegen, was etwa zu Gelenkproblemen führen kann. Um dies zu verhindern, entwickelten die Forscher eine Art Latrinentraining für Kälber, schließlich müssen auch menschliche Kinder die Kontrolle über ihre Ausscheidungen erlangen, also warum nicht auch Kälber. Die Forscher versuchten dafür den Lerneifer der Tiere zu nutzen.
Bei Nutzung eines bestimmten Ortes bekamen die Kälber Futter, wenn nicht erhielten sie einen kalten Wasserguss. 11 von 16 Kälbern lernten innerhalb von wenigen Tagen, die Kuhtoilette zu nutzen. Für den Halter hat dies den Vorteil, dass der Urin getrennt gesammelt und abtransportiert oder anderweitig genutzt werden kann. Das Erlernen der Harnkontrolle bedeutet, dass die Kälber über ein interozeptives Bewusstsein verfügen, also die Fähigkeit, wahrzunehmen, was in ihrem eigenen Körper vor sich geht. Das Experiment zeigt verallgemeinert, wie eng Lernen, Wahrnehmen und Fühlen und damit die Grundvoraussetzungen für die Existenz von Bewusstsein miteinander verknüpft sind.
Von vielen sozial lebenden Tieren ist bekannt, dass bereits die Anwesenheit eines vertrauten Artgenossen oder menschlichen Bezugspartners Stress abpuffern kann, der beispielsweise nach der Trennung von der Mutter auftreten kann. Die Forscher konnten dies nun auch bei Schweinen und Ziegen nachweisen. Des Weiteren wollten die Forscher herausfinden, ob diese Tiere auch untereinander Empathie empfinden können. Dazu betrachteten sie die akustische Verständigung der Tiere untereinander. Dabei wollten sie außerdem wissen, ob die Laute auch etwas über den emotionalen Zustand aussagen. In einem Playback-Experiment zeigte sich, dass Stresslaute von Artgenossen zu einer erhöhten Aufmerksamkeit der zuhörenden Tiere führen.
In einem weiteren Versuch ersannen die Forscher eine Box, die Ferkel von außen mit einem Hebel öffnen und so die unbekannte Umgebung erforschen konnten. Aber die Tür fiel hinter den Ferkeln zu und konnte von innen nicht geöffnet werden. Die Ferkel draußen erkannten die Stresslaute der gefangenen Ferkel. In 20 Minuten wurden 85% der 75 Tiere von einem Artgenossen aus der Box herausgelassen. Die Hilfsbereitschaft stieg, stärker klagend das gefangene Ferkel quiekte. Ähnliches wurde schon 2020 von tschechischen Forschern bei Wildschweinen mit Wildkameras beobachtet, die in einem Wildgehege in einer Käfigfalle saßen.
Sollte sich weiterhin bestätigen, dass Schweine eine emotionale Notlage ihrer Artgenossen erkennen, stellen sich eine Reihe von ethischen Fragen bezüglich Wohlbefinden bei der Haltung.
Ein weiteres Experiment befasste sich damit, wie gut Schweine mit Belohnungsaufschub umgehen können. Das heißt, das Tier erkennt, dass es für ein Verhalten nicht sofort, sondern verzögert belohnt wird. Man kennt dies als Marshmallow-Experiment aus den 1970ern. Ein Kind sitzt an einem Tisch, auf dem ein Marshmallow liegt. Das Kind darf die Süßigkeit sofort essen, aber erhält die Information, wenn es etwas wartet, erhält es noch einen zweiten Marshmallow. Wenn es dagegen das erste Marshmallow isst, bevor das zweite da ist, erhält es das zweite nicht. Je nach Alter verstehen Kinder das.
Dieses Experiment wurde seither auch mit verschiedenen Tieren und in abgewandelter Form angewandt. 2021 versuchte es das Forscherteam mit Hausschweinen. Mit etwas Training, in dem der Zeitpunkt bis zum zweiten Leckerli immer weiter hinausgezögert wurde, warteten schließlich 13 ältere Schweine bis zu 11 Sekunden, bevor sie sich nicht mehr zurückhalten konnten. Bei Ferkeln schafften es 6 von ihnen bis zu 8 Sekunden zu warten.
Der Test zeigt, das Verhalten vieler Tiere wird durch ein erstaunliches Maß an gegenwärtiger, aber auch auf die unmittelbare Zukunft gerichteter kognitiver Selbstreflexion gesteuert. Damit dürfte auch klar sein, dass auch Hunde sehr wohl lernen können, dass sie eine verzögerte Belohnung für ein zurückliegendes Verhalten bekommen.
Ein weiteres Experiment untersuchte, wie sich Tiere in Gefangenschaft entscheiden, wenn sie vor der Wahl stehen, Futter direkt ohne Aufwand oder erst nach einer Erledigung einer Aufgabe erhalten, also quasi dafür arbeiten müssen. Bei Ziegen zeigte sich, ungefähr ein Drittel entscheidet sich, die Aufgabe zu lösen. Dahinter stecken vermutlich zwei wichtige Verhaltensbedürfnisse: Erstens die selbstmotivierte Suche nach Nahrung und zweitens die Beschaffung von Information. Dieses Wissen kann in der Nutztierhaltung zur Steigerung des Tierwohls angewendet werden, indem man für die Tierart und ihren kognitiven Fähigkeiten geeignete Aufgabenstellungen entwirft.
Und schließlich ging es um die Frage, was tun Tiere, die vor einer Aufgabe stehen, sie aber nicht lösen können. Bei Ziegen versuchten diese dann den menschlichen Versuchsleiter durch Blick- und Körperkontakt dazu zu bewegen, zu Hilfe zu kommen. Dieses Verhalten war bislang von Nutztieren nicht bekannt. Man kennt diese Versuche seit längerem von Haushunden, die mit ihren Bezugsmenschen dann intensiv interagieren. Die Tiere sehen den Menschen als soziale Bezugsperson an. Wölfe in einem Wildgehege tun dies nicht, trotz verfügbarer enger Bezugspersonen. Es ist also ein mit der Domestikation erlerntes vererbtes Verhalten. Solche einfachen Versuche demonstrieren, wie wichtig eine funktionierende Mensch-Tier-Beziehung für Tiere in menschlicher Obhut ist.
Wir haben unsere Nutztiere bezüglich ökonomischem Nutzen und aus hygienischen und arbeitsorganisatorischen Gründen optimiert. Umso erstaunlicher ist es, dass wir zwar einiges über allgemeine und spezielle Verhaltensmuster wissen, allerdings vergleichsweise wenig darüber, was diese als fühlende und denkende Wesen ausmacht und wie sie ihre physische und soziale Umwelt wahrnehmen und bewerten. Dies sollte in der zukünftigen Diskussion ums Tierwohl angemessen berücksichtigt werden.
Grüße
CdB